Die junge Mary schreibt einen Brief. An wen, wissen wir nicht. Aber es gibt etwas, das sie unbedingt erzählen muss, etwas, das zu sagen, ihr schwerfällt und das sie doch nicht für sich behalten möchte. Und weil Dinge nie aus sich heraus passieren, sondern auf Vorangegangenes aufbauen, beginnt Mary ihre Geschichte ganz am Anfang, da, wo jede gute Geschichte beginnt. Sie blickt zurück auf ihre Kindheit, die eigentlich keine gewesen ist: Gemeinsam mit ihren Schwestern schuftet sie sich seit Jahr und Tag auf dem Bauernhof und Feldern der Familie ab. Dabei stehen sie immer unter dem strengen Blick des Vaters, der vor Schlägen nicht zurückschreckt und für den der Ertrag das einzige ist, das zählt. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird ohne Pause gearbeitet. Vermutlich würde der Vater die Töchter auch nachts schuften lassen, hätte er nicht festgestellt, dass sie am nächsten Tag besser arbeiten, wenn sich ihre Körper in der Nacht erholten. Dennoch ist ihm die Leistung der Töchter nie genug – einfach, weil sie Frauen sind. Jahr für Jahr zürnt der Vater, dass ihm das Leben nur Töchter und keinen einzigen Sohn geschenkt hat. Und dann auch noch ein Kind wie Mary: mit einem krummen Bein, einer direkten, forschen Art zu reden, einer blassen Haut und Haar in der Farbe von Milch. In seinen Augen taugt Mary daher weder als zukünftige Ehefrau noch als Arbeiterin auf dem Feld.
Eines Tages bittet der Pfarrer des Dorfes den Bauer darum, eine seiner Töchter als Hilfe einstellen zu können. Der Bauer zögert nicht und entsendet Mary zur Pfarrersfamilie – auf dem Hof ist sie schließlich keine große Hilfe und das regelmäßige Geld kann die Familie gut gebrauchen.
Lange zeigt sich Mary widerspenstig und kritisiert alles im Haus des Pfarrers, obwohl es ihr dort besser ergeht als bei ihrer Familie. Mary kümmert sich täglich um die schwerkranke Frau des Pfarrers, die das Mädchen trotz (oder wegen?) seiner schonungslos offenen Art schnell ins Herz schließt. Die Arbeit ist dabei weniger anstrengend als auf dem Feld und zwischendurch gibt es tatsächlich Minuten, in denen Mary auch einmal Pause machen kann – etwas, das dem Mädchen völlig fremd ist. Sie bekommt sogar neue Kleidung und schläft zum ersten Mal in ihrem Leben allein in einem Bett.
So scheint es, dass sich Marys Leben zum Besseren wendet. Doch ihrem Brief können wir immer wieder entnehmen, dass ihr etwas Schlimmes widerfahren ist.
Was ihr zugestoßen ist, berichtet Mary aber tatsächlich erst im letzten Viertel des Buches. Bis dahin erleben wir den gängigen Alltag des Mädchens in all seinen Routinen, Alltäglichkeiten, kleinen und großen Sorgen. Nach Lesen des Klappentextes kann sich allerdings jede*r denken, was Mary passieren wird und worauf die Geschichte hinausläuft.
Genau das ist auch das große Problem, das ich mit dem Roman der derzeit viel gelobten Nell Leyshon habe: Er kann nicht überraschen, erzählt nichts, was wir nicht schon tausendfach gelesen und gesehen haben. Ich wartete und wartete auf das angekündigte Ereignis, dessen Natur ich eh schon kannte und das ich aufgrund des Klappentextes als Aufhänger einer sich größer entfaltenden Geschichte vermutete. Tatsächlich passiert in den ersten drei Vierteln ziemlich wenig und schon gar nichts Spektakuläres. Das ist an sich nichts Schlimmes, aber irgendwann stellte sich mir die Frage, worauf Nell Leyshon jetzt endlich hinauswill und ich wurde zunehmend ungeduldiger. Als das von Mary mehrfach angekündigte Erlebnis schließlich eintritt, ist die Geschichte auch schon kurz darauf vorbei. „Die Farbe von Milch“ wirkt daher wie ein zielloses Vorspiel, das viel zu lange dauert, sodass für den eigentlichen Akt keine Zeit mehr bleibt. Am Ende saß ich enttäuscht vor dem Hörbuch und dachte nur: „Das war’s jetzt?“
Dabei hat „Die Farbe von Milch“ grundsätzlich eine Menge Potenzial. Mary ist eine sehr facettenreiche und interessante Figur, deren Leben ich gern verfolgt habe. Bei den Nebenfiguren werden indes viele Fäden aufgenommen und miteinander verstrickt, um dann lose fallen gelassen zu werden. So hätte Nell Leyshon beispielsweise die Geschichten um Marys Großvater oder den Pfarrerssohn deutlich ausbauen können.
Sprachlich überzeugt Nell Leyshon dagegen sehr. Ihr Stil ist schnörkellos, kurz und treffend. Damit passt er perfekt zu Marys Charakter und ihrer Art, alles offen auszusprechen. In der Hörbuchversion hat Laura Maire diese forsche, unverblümte Art gekonnt eingefangen. Ihre Stimme changiert zwischen jugendlicher Leichtigkeit und einer ernsten Weitsicht, wie sie auch in Marys Charakter zu finden sind. „Die Farbe von Milch“ ist daher an sich ganz nett zu hören bzw. zu lesen, dramaturgisch aber leider misslungen.
Fazit:
Für eine längere Reise ist Nell Leyshons „Die Farbe von Milch“ nicht die schlechteste Wahl. Wer den Roman nicht liest/ hört, hat allerdings auch nichts verpasst.
Nell Leyshon: „Die Farbe von Milch“ (Hörbuch, gelesen von Laura Maire), aus dem Englischen übersetzt von Wibke Kuhn, Random House Audio 2019, ISBN: 978-3-8371-4276-1
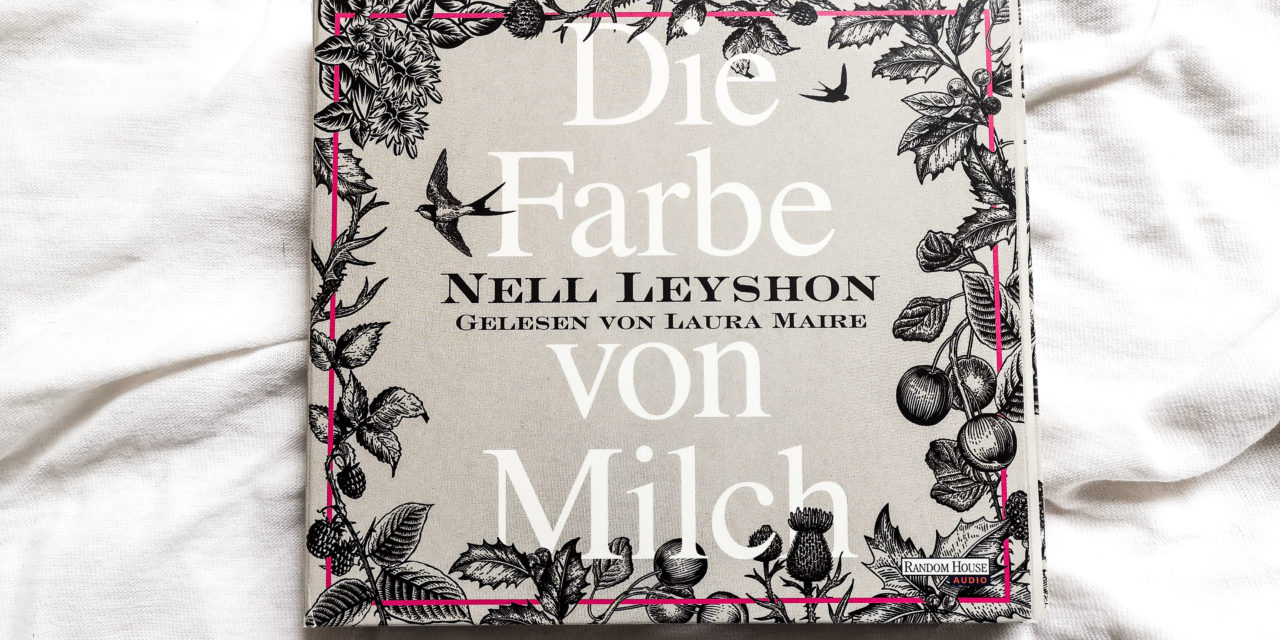

Hm, das Buch habe ich auch auf der Wunschliste, ich werde dann zumindest mal den Klappentext meiden. Danke für den Hinweis!
Liebe Anette,
das ist eine gute Idee! Ich frage mich auch immer wieder, ob mir das Buch besser gefallen hätte, wenn ich nicht schon vorher gewusst hätte, worauf alles hinausläuft. Andererseits gibt es aber auch im Buch selbst genug Andeutungen, aus denen erfahrenere Leserinnen schnell Rückschlüsse ziehen können, sodass ich vermutlich auch ohne den Klappentext hohe Erwartungen an den Fortgang der Handlung gehabt hätte.
Falls du es liest, wäre ich sehr interessiert daran, wie du das Buch wahrnimmst.
Liebe Grüße und einen schönen Pfingstmontag!
Kathrin
Sorry für das späte „Danke“! :-)
Uh, das Buch hatten wir schon mal als Vorschlag im Buchclub. Alle waren von der Covergestaltung hin- und hergerissen, aber es wurde doch mit irgendwas anderem überstimmt. Seitdem habe ich mir hin- und wieder mal vorgenommen das Buch nachzuholen. Allerdings greife ich vielleicht doch zum Buch statt zur Audioversion, da derjenige, der uns damals das Buch vorgeschlagen hat es u.a. damit angepriesen hat, dass man im Stil wie es geschrieben ist etwas besonderes erkennen sich. Er wollte aber nicht zuviel verraten und ich meide andere Reviews, um nicht zuviel von der Handlung mitzukriegen … hast du im Hörbuch sowas bemerkt? Ich denke es geht in die Richtung, dass Mary aufgrund ihrer Bildung Rechtschreibfehler im Text hat oder sowas in der Art.
Wie du merkst, bin ich trotz allem noch angefixt ;)
Die Cover von Nell Leyshons Büchern sind auch dran schuld, dass mir ihre Bücher und die Lobeshymnen darauf so gut in Erinnerung blieben. Ich werde auch sicherlich noch einmal ein anderes Buch von ihr lesen, auch wenn mich „Die Farbe von Milch“ nicht begeistern konnte.
Also von Rechtschreib- oder Grammatikfehlern habe ich beim Hören nichts gemerkt. Allerdings spiegelt sich die bescheidene Bildung von Mary sehr in der Wortwahl und dem Satzbau: Alles ist relativ schlicht gehalten, ungekünstelt und sehr direkt. Alles andere wäre auch nicht authentisch gewesen, da das Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Darüber hinaus spricht Mary fremde und kompliziertere Wörter häufig falsch aus, bis sie korrigiert wird, oder verwechselt die Bedeutung zweier ähnlich klingender Wörter.
Falls du es tatsächlich lesen solltest oder ihr vielleicht sogar doch im Buchclub behandelt, musst du mich unbedingt auf dem Laufenden halten, wie du und die MitleserInnen es wahrgenommen haben! :)